Nichtaristotelisches Drama

in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues
Thema lernen in nur 12 Minuten?
-
 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.
92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.
93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen
Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.
94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.
Grundlagen zum Thema Nichtaristotelisches Drama
In der griechischen Antike entwickelte Aristotles in seiner Poetik das Ideal der Tragödie. Jahrhundertelang hielt man sich an diese Regeln, ja feilte sogar noch an ihnen. Doch diese Regeln waren sehr streng und es gab immer wieder Ausbrüche. Wir werden uns in diesem Video mit diesen Ausbrüchen und dem Überwinden dieser Regeln befassen. Wir schauen uns die wichtigsten Umdenker und ihre Werke an und werden sehen, was deren Stücke neues bringen. Viel Spaß beim Zusehen und viel Erfolg beim Lernen!
Transkript Nichtaristotelisches Drama
Wenn es darum ging, ein Theaterstück zu schreiben, war es bis ins 18. Jahrhundert hinein üblich, sich an den Regeln des Aristoteles zu orientieren. Doch das sogenannte aristotelische Drama wurde wegen seiner strengen Regeln auch kritisiert. Immer wieder gab es Ausbrüche aus diesem Raster und immer wieder kehrten große Autoren dazu zurück.
Heutzutage ist der Regelzwang aufgehoben und es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Theaterstücke zu schreiben. In diesem Video werden wir uns mit den einflussreichsten Ausbrüchen aus dem aristotelischen Drama beschäftigen und den Weg zum heute vorherrschenden, sogenannten “nichtaristotelischen Drama” beschreiten.
Das aristotelische Drama
Zuvor sehen wir uns das aristotelische Drama noch einmal an: Aristoteles legte strenge Regeln für den Aufbau des Dramas fest. Die wichtigste ist die Einheit von Ort, Zeit und Handlung: Es sollte keine groß angelegten Nebenhandlungen geben, der Ort sollte beibehalten werden und die Geschichte binnen eines Tages spielen.
Darüber hinaus sorgte die Ständeklausel immer wieder für starke Kritik; in Tragödien - also Stücken ohne Happy End - sollte nur das Schicksal von hohen Persönlichkeiten beschrieben werden. Nur diesen großen Menschen könne wirklich Tragisches widerfahren, so die Begründung. Inwieweit weicht das nichtaristotelische Drama davon ab?
Das bürgerliche Trauerspiel nach Lessing
Der erste große und theaterverändernde Kritiker dieser Ständeklausel war 1769 Gotthold Ephraim Lessing. In seiner Hamburgischen Dramaturgie legte er den Grundstein für eine neue Art der Tragödie, das bürgerliche Trauerspiel. Er hatte ein Kunstideal, das der sittlichen Besserung der Menschen dienen sollte. In den Fokus seiner Dramen rückt nun die bürgerliche Schicht. Nicht mehr Könige oder Herrscher werden porträtiert, sondern die Sorgen und Probleme von Nicht-Adligen.
In seinem ersten bürgerlichen Trauerspiel “Miss Sara Sampson” beschreibt Lessing die tragische Geschichte einer Bürgerstochter und ihrer unglücklichen Liebe. Hier werden also private Schicksale behandelt. Gleichzeitig löst sich die von Aristoteles geforderte Verssprache auf, das Trauerspiel ist hier in Prosa gehalten.
Goethes Faust
In den folgenden Jahren und Jahrzehnten gibt es immer wieder ähnliche Abweichungen von den Regeln des Aristoteles. Johann Wolfgang von Goethe lässt in seinem Faust 1808 einen Gelehrten in den Mittelpunkt treten und die ganze Welt bereisen - von der Einheit des Ortes keine Spur mehr.
Schiller und Shakespeare
Nebenhandlungen werden zu einem wichtigen Gestaltungsmittel des Dramas, was schon in Stücken wie Shakespeares “Sommernachtstraum” deutlich wird. Die Einheit der Handlung wird brüchiger. Gerade auch im Sturm und Drang - wie bei “Die Räuber” von Schiller - werden die alten Regeln zum Großteil über Bord geworfen, denn das Stück umfasst einen Zeitraum von über einem Jahr.
Avantgarde
Zur großen Überwindung der aristotelischen Lehren kommt es jedoch erst vollkommen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Junge Theatermacher beginnen damit, die Grenzen des Theaters auszutesten. Avantgarde werden sie genannt. Sie versuchen neue Schwerpunkte zu setzen, indem sie zum Beispiel versuchen, die Arbeit des Schauspielers inhaltlich neu zu definieren, wie es Bertolt Brecht tat.
Das epische Theater
In seinem epischen Theater geht es nicht mehr um das Einfühlen in die Figur und eine Reinigung des Geistes. Er fordert eine kritische Distanz des Schauspielers zu dem, was er spielt. Theater wird außerdem politisch, der Schauspieler soll seine Sicht auf die Handlung verkörpern, keine Rolle oder Figur. Theater als Illusion verachtet er, in seinen Augen soll der Zuschauer stets wissen, dass er im Theater ist, und sich nicht in eine Geschichte fallen lassen können.
Totaler Bruch mit dem aristotelischen Drama
In den 1950er Jahren kommt es dann, nach Brecht, zu einer weiteren Form des Theaters, die total mit Aristoteles bricht: 1952 erscheint “Warten auf Godot” des irischen Schriftstellers Samuel Beckett. Zwei ältere Herren warten hier das gesamte Stück über auf Godot, von dem man nie erfährt, wer das ist. In diesem Stück geht es offenbar um nichts.
Die Sprache ist von Sinn entleert, die Figuren tun nicht das, was sie sagen. Auch weiß man nicht, wie lange sie dort sitzen oder welchen Zeitraum das Stück umfasst. Die Situation und die Figuren sind absurd. Und so heißt diese neue Form des Theaters auch: Absurdes Theater. Eine Reihe von Schriftstellern, wie Eugene Ionesco, Samuel Beckett oder Albert Camus sind Vorreiter dieses neuen Stils.
Nicht ihre Stücke seien absurd, sagen sie, sondern das moderne Leben des Menschen, die Gesellschaft und eben das wollen sie in den Stücken spielen. *Existenzialistische Ideen der Ausweglosigkeit des Einzelnen fließen ebenso in das Theater ein wie eine gute Prise bitteren Humors**.
Elfriede Jelineks Dramen
In Elfriede Jelineks Dramen, die seit den 70er-Jahren aufgeführt werden, ist schließlich gar nichts mehr von dem zu erkennen, was Aristoteles einst definierte. Hier finden sich gar keine Figuren mehr, der Text ist reiner Fließtext mit vielen Wiederholungen, die Sprache als solche steht im Vordergrund und verweist auf sich selbst. Die Postdramatik und die Postepik versuchen diese neuere Strömungen bis heute zu umschreiben.
Zusammenfassung zum Nichtaristotelische Drama
Fassen wir also noch einmal zusammen: Nichtaristotelische Dramen gab es schon immer. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine oder mehrere Regeln des aristotelischen Dramas brechen. Die Handlung wird sehr frei über Ort und Zeit ausgebaut, die Szenen werden eigenständig. Es gibt nicht mehr nur eine Handlung, sondern mehrere Parallel- oder Nebenhandlungen.
Lessing überwindet das aristotelische Drama als erster im großen Stil, indem er die Ständeklausel aufhebt. Der Sturm und Drang nutzt seine Überlegungen und führt sie weiter. Im 20. Jahrhundert dann gibt es viele Ansätze, die “Drama” neu definieren. Heute finden wir auf den Bühnen alle möglichen Formen von Theaterstücken nebeneinander: vom aristotelischen über das epische Theater Brechts bis hin zum Absurden, Postdramatischen und Postepischen Theater.
Nichtaristotelisches Drama Übung
-
Beschreibe das postepische Theater.
TippsElfriede Jelinek ist eine Vertreterin des postepischen Theaters. Was sind die Besonderheiten ihrer Stücke?
Ein Synonym ist Postdramatik. Post bedeutet nach. Hilft dir das bei der Lösung der Aufgabe?
LösungDas postepische oder auch postdramatische Theater bildete sich in den 1970er Jahren heraus.
- Es gibt gar keine Figuren mehr in den Dramen.
- Die Dramen bestehen aus reinem Fließtext.
- Diese beiden Fakten unterstützen, was im Vordergrund stehen soll: die Sprache.
- Eine wichtige Vertreterin ist Elfriede Jelinek. Schau dir doch zum Beispiel einmal „Kein Licht” an und versuche, die Merkmale auszumachen.
-
Definiere das epische Theater nach Bertolt Brecht.
TippsAls Zuschauer soll man sich laut Brecht nicht mit den Figuren identifizieren. Wie kann man das noch ausdrücken?
LösungZu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionierte Bertolt Brecht des Theater.
Sein episches Theater kann so beschrieben werden:
- Der Zuschauer soll nicht mehr durch das Anschauen des Stücks seinen Geist reinigen oder sich in die Figur hineinversetzen, wie es noch beim aristotelischen Drama vorgesehen war. Stattdessen sollte er durch das Stück immer wieder zum Nachdenken und Reflektieren angeregt werden.
- Auch die Schauspieler sollten eine kritische Distanz zu ihren dargestellten Figuren wahren.
- Außerdem soll der Schauspieler seine politische Sicht verkörpern und nicht nur eine Rolle.
- Für Brecht war die Illusion etwas, das nichts im Theater zu suchen hat. Dem Zuschauer sollte immer bewusst sein, dass er sich im Theater befindet.
-
Ermittle die Wirkung des epischen Theaters nach Bertolt Brecht.
TippsDer so genannte Verfremdungseffekt, durch den vertraute Gegenstände absurd verändert werden, soll beim Zuschauer Verblüffung hervorrufen.
LösungBertolt Brecht hatte klare Vorstellungen davon, wie sein episches Theater umgesetzt werden sollte. Auch eine bestimmte Wirkung intendierte er.
- Durch den Verfremdungseffekt, auch V-Effekt genannt, und das damit hervorgerufene Staunen wird eine Erkenntnis für den Zuschauer ermöglicht.
- Ohne Einfühlung ist nicht ein Miterleben, sondern die Auseinandersetzung mit dem Stück möglich. Die Einfühlung wird oft durch gleichnishafte Charaktere der Stücke verhindert.
- Zum V-Effekt gehören auch die Beleuchtung, Plakate und andere Objekte der Bühnengestaltung, die dem Zuschauer zeigen sollen, dass er sich im Theater befindet.
- Auch wenn diese Dinge surreal wirken, war Brecht Realismus wichtig. Die Wirklichkeit sollte schließlich hinterfragt und musste deshalb zuerst erkannt werden.
-
Ermittle die Dramenformen der Textausschnitte.
TippsÜberlege noch einmal, für welche Dramenform der Fließtext typisch ist.
Lösung- Der erste Ausschnitt aus dem Drama „Das Schweigen” besteht aus reinem Fließtext. Das ist typisch für das postdramatische Theater, besonders bei Elfriede Jelinek. In ihren Dramen gibt es keine Figuren und die Sprache steht eindeutig im Vordergrund. Die österreichische Schriftstellerin erhielt bereits den Nobelpreis für Literatur.
- Das zweite Beispiel ist ein Dialog aus Becketts absurdem Theaterstück „Warten auf Godot“. Wladimir und Estragon treffen sich jeden Tag, um auf Godot zu warten. Sie wissen allerdings nicht, wer Godot ist und ob er jemals kommen wird. Absurde Dramen bestehen oft aus grotesk-komischen und irrealen Szenen, die eine sinnlose Welt darstellen sollen. Die Dialoge dienen nicht dem Verständnis, sondern einem banalen, ziellosen Reden.
- Beim letzten Beispiel handelt es sich um episches Theater. Der Prolog wird sozusagen „episiert”: Der Zuschauer wird bewusst darauf hingewiesen, dass er sich im Theater befindet. Jegliche Illusion soll aufgehoben werden.
- Jelinek, Elfriede: Das Schweigen. URL: http://www.elfriedejelinek.com/ [abgerufen am 28.07.2015].
- Beckett, Samuel: Warten auf Godot. Paris 1952.
- Brecht, Bertolt: Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. edition suhrkamp. Berlin 1957.
-
Beschreibe die wichtigsten Merkmale des aristotelischen Dramas.
TippsDie Bestandteile des aristotelischen Dramas sind Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, retardierendes Moment und Katastrophe. In wie viele Akte kann das verpackt werden?
LösungLange Zeit war es üblich, sich an die Regeln des aristotelischen Dramas zu halten. Aristoteles lebte von 385-322 v. Chr. und war ein griechischer Philosoph. Laut Aristoteles gab es grundsätzliche Kriterien, die ein Theaterstück erfüllen musste:
- Es gibt eine Ständeklausel, die besagt, dass nur Figuren mit einer hohen gesellschaftlichen Stellung in Tragödien mitspielen durften. Genauer gesagt bedeutet das, dass die Hauptfiguren meist Könige oder Götter waren. Die Bürger konnten als Figuren nur in Komödien auftreten.
- Außerdem schrieb Aristoteles eine Einheit von Ort, Zeit und Handlung vor, entsprechend musste das Stück an einem einzigen Handlungsort stattfinden, einen zusammenhängenden, kurzen Zeitraum umfassen und durfte keine Nebenhandlungen haben. Hinzu kam eine meist begrenzte Anzahl an Figuren.
- Formal ist beim aristotelischen Drama die Versform üblich.
- Weiterhin bestehen Dramen meist aus fünf Akten.
-
Nenne typische Merkmale des epischen Theaters, die in Brechts „Die Dreigroschenoper” auftauchen.
TippsÜberlege noch einmal, welche Mittel dem V-Effekt zugeordnet werden können.
Auch wenn du den Text nicht kennst, kannst du anhand der Beschreibungen erkennen, welche Handlungen und Darstellungsmittel den Zuschauern bewusst machen sollen, dass sie im Theater sind.
Schaue dir die Videos zu „Die Dreigroschenoper“ auf unserer Plattform an.
Lösung„Die Dreigroschenoper”, die erfolgreichste deutsche Theateraufführung bis 1933, folgt Bertolt Brechts eigener Definition des epischen Theaters. Es geht um konkurrierende Bettlergruppen in Form einer Firma und einer Mafia im Londoner Stadtteil Soho:
- Das Stück bildet die Wirklichkeit ab: Es geht um die Armut von Bettlern in London. Im Gegensatz zum aristotelischen Drama sind hier nicht Könige oder Götter die Hauptfiguren.
- Mit Kommentaren und Liedern wird der Verfremdungseffekt umgesetzt. Dieser ist typisch für Brechts Stücke. So zum Beispiel der Morgenchoral des Peachum oder der Anstatt-Dass-Song. Dieser ist auch auf Tafeln angekündigt.
- Mit diesem soll dem Zuschauer bewusst gemacht werden, dass er sich im Theater befindet. Es soll keine Illusion aufkommen.
9'182
sofaheld-Level
6'600
vorgefertigte
Vokabeln
7'643
Lernvideos
35'607
Übungen
32'360
Arbeitsblätter
24h
Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Schulstufen.
Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.
Testphase jederzeit online beenden
Beliebteste Themen in Deutsch
- Präteritum
- Perfekt
- Präsens
- Artikel
- Subjekt
- Plusquamperfekt
- Umlaute
- Satzbau Deutsch
- Bestimmte Und Unbestimmte Artikel
- Buchvorstellung Planen
- Pronomen Grundschule
- Selbstlaute, Doppellaute Und Umlaute Erkennen
- Was Ist Ein Subjekt
- Possessivpronomen
- Anapher
- Gedichtinterpretation Schluss
- Prädikat
- Konjunktiv I
- Denotation, Konnotation
- Wortarten
- Metapher
- heute Morgen
- Desweiteren oder des Weiteren
- als oder wie
- Komma vor oder
- Sowohl als auch - Komma
- Seit oder seid
- Bilderrätsel
- Komma vor aber
- bis auf weiteres
- einzige oder einzigste
- Komma vor wie
- Komma vor und
- morgens
- Rhetorische Frage
- Komma vor als
- weder noch Komma
- morgen groß oder klein
- Komma vor um
- Bescheid geben groß oder klein
- auf grund oder aufgrund
- Komma vor sondern
- Mitlaute
- öfter oder öfters
- euch groß oder klein
- ebend
- Du hast Recht
- wart oder ward
- Personalpronomen
- Sie groß oder klein




 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen

 Bereit für eine echte Prüfung?
Bereit für eine echte Prüfung?

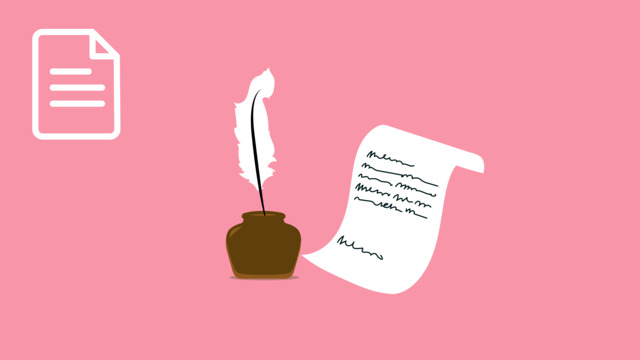















Hallo,
ich beschäftige mich derzeit mit Faust.
Eure Erklärung zur Theatergeschichte hat meiner Meinung nach einen großen Fehler, denn ihr lasst die Entwicklung des elisabethanischen Theaters außer acht. Weder der Einfluss Shakespeares noch Marlowes auf Schiller, Goethe und Lessing werden berücksichtigt.
Lieben Gruß Ritschel